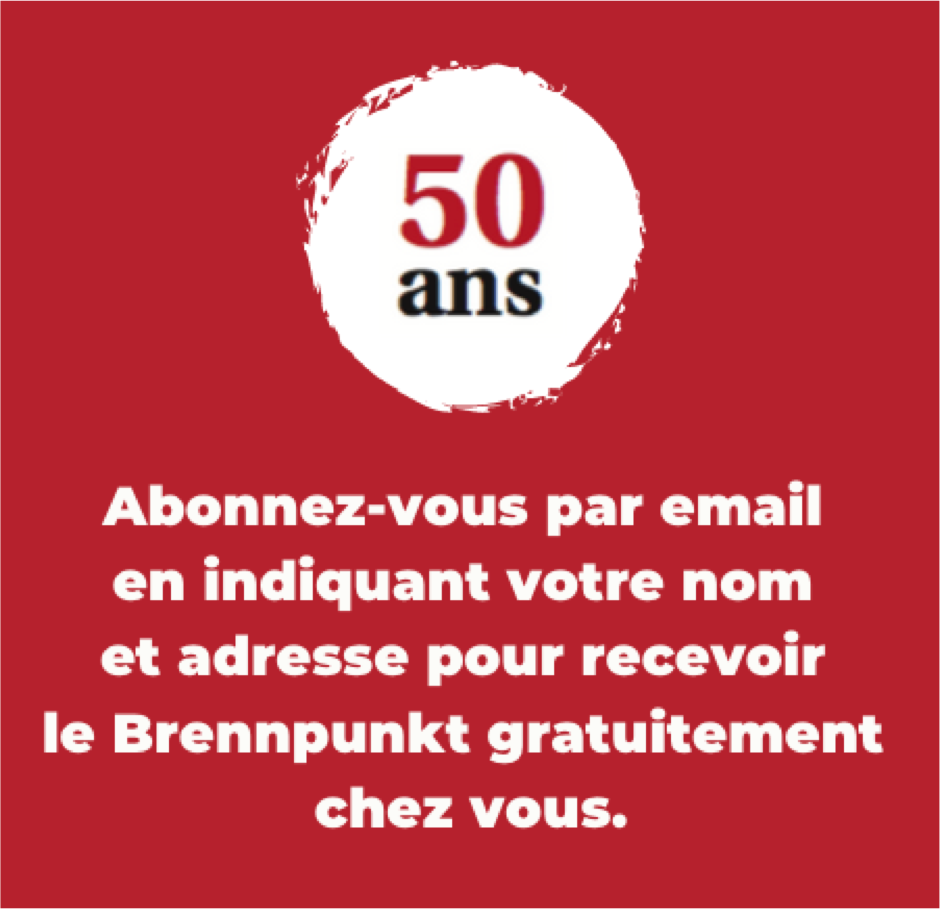Wir stehen an einem historischen Scheideweg. Die Klimakrise verschärft Intensität und Frequenz von Extremwetterereignissen wie Dürren, Stürme, Hochwasser, Extremregen und -hitze und führt zu langfristigen Umweltveränderungen wie dem Anstieg des Meeresspiegels, Artensterben und Bodendegeneration. Mit jedem Grad der Erderhitzung kommen wir der Restrukturierung der Welt in zukünftig noch bewohnbare und bald nicht mehr bewohnbare Weltregionen näher. In letzteren wohnen aktuell ein Drittel der Menschheit.
Klimakrisen induzierte Katastrophen haben aber auch schon jetzt ein dramatisches Ausmaß angenommen. Laut eines Berichtes des Roten Kreuzes wurden 2020 mehr als 50 Millionen Menschen von über 100 klima- und wetterbedingten Katastrophen heimgesucht. Dabei liegen die Hauptrisikogebiete für diese Formen der Zerstörung vor allem in Südasien, dem Nahen Osten und Afrika, obwohl sie im Verhältnis zu den Industrienationen des globalen Nordens wie den USA, Deutschland und Großbritannien historisch viel weniger zu deren Verursachung beigetragen haben.
Während einige Regierungen, beispielsweise in Indonesien oder kleineren Inselstaaten, auf Überschwemmungen bereits mit der Verlegung ganzer Stadtteile zu reagieren versuchen, sind gerade Menschen im globalen Süden, die in ländlichen Gebieten vom Ackerbau und der Viehzucht leben, von den Auswirkungen der Klimakrise besonders gravierend betroffen. Ihre spärlichen Habseligkeiten werden nicht nur immer wieder erneut durch Extremregen, Sturmfluten und Überschwemmungen zerstört, wodurch sie jedes Mal aufs Neue in ihrem erarbeiteten Wohlstandsniveau um Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte, zurückgeworfen werden. Die Katastrophen haben auch langfristige Auswirkungen. Bodenerosion, drastische Verringerung der Fruchtbarkeit, Verseuchung mit Abwässern und Chemikalien führen zu Unnutzbarkeit. Extremhitze verlängert die Zeitabschnitte in denen Feldarbeit schier unmöglich ist. Fischschwärme verenden wegen steigender Temperaturen oder verlagern sich in tiefere Meeresregionen und sind außerhalb des industriellen Fischfangs nur noch schwerlich erreichbar. Der Zugang zu nicht kontaminiertem Trinkwasser wird rar. Die regelmäßige und wiederkehrende Zerstörung von Einrichtungen der öffentlichen Infrastruktur, wie Bewässerungskanäle, Straßen, Schulen und Krankenhäuser, behindert gesellschaftliche Entwicklung und trifft arme und mittellose Bevölkerungsgruppen am stärksten. In vielen Hauptrisikoregionen wird ein so verursachter Einbruch der Wirtschaftsleistung von bis zu 20 Prozent prognostiziert.
Diese klimabedingten Veränderungen wirken selten isoliert. Sie verschärfen bestehende gesellschaftliche Krisen wie Armut, politische Instabilität oder Gewalt und bringen neue und intensivierte Ungleichheit hervor. Aber auch auf der Ebene der einzelnen bringen die Klimakatastrophen Millionen von Menschen an die Grenzen ihrer Resilienzfähigkeit. Verschuldung und Verzweiflung nehmen gleichermaßen zu und zwingen Menschen ihre bisherigen Wohnorte zu verlassen, weil dort selbst unter großen Konzessionen für sie kein Leben mehr möglich ist. Mit jeder Dürre, jedem Hochwasser, jedem Ernteausfall wächst der Druck weiter und Existenzen geraten ins Wanken. Die Zunahme der Aussichtslosigkeit treibt die Menschen auf die Migrationsrouten.
Bereits 2018 wurden weltweit 17,2 Millionen Menschen in 144 Ländern und Gebieten aufgrund von Umweltkatastrophen wie Stürmen oder Starkregen vertrieben. Die Groundswell-Studie der Weltbank (2021) kommt zu dem Ergebnis, dass die Klimakrise bis Mitte des Jahrhunderts 216 Millionen Menschen dazu zwingen wird zu migrieren. Diese Bewegungen finden absolut überwiegend als Binnenmigrationen statt, lassen die urbanen Zentren oft explosionsartig anwachsen und schaffen neue unbewältigte Probleme von Überausbeutung und Stadtplanung.
Verrohung nach innen und außen
All das ist keine neue Erkenntnis, allein eine ernstzunehmende Politik der Begrenzung der Erderhitzung und Bearbeitung von Klimakrisenfolgen ist schwerlich erkennbar. Zu verzeichnen ist sogar der gegenteilige Trend einer „drill baby drill“-Mentalität.
Auch wenn es nach jahrzehntelangen Kämpfen gelungen ist, die Frage von Kompensationsleistungen für besonders von Klimakrisenschäden betroffene Weltregionen auf die Tagesordnung der Vereinten Nationen zu pushen und einen Fonds für loss&damage einzurichten, scheitert dieser, wie so ziemlich alles an globalen Klimavereinbarungen, am politischen Willen zu deren Umsetzung. Der Fonds krankt an mangelnder Zahlungsmoral und fehlenden Einzahlungs- wie Auszahlungsmodalitäten und bietet Gesellschaften, denen die Kapazitäten zur Bewältigung der Klimaschäden fehlen, bisher keinerlei Hilfe.
Auch Mittel zur Klimafinanzierung ändern das nicht. In den letzten zehn Jahren wurden diese von den Industrieländern in erster Linie über ihre multilateralen Entwicklungsbanken in Form von Darlehen und Krediten bereitgestellt. Kredite mussten so von betroffenen Ländern zu marktüblichen Zinssätzen zurückgezahlt werden und haben oftmals die Staatsverschuldung drastisch erhöht, anstelle zu entlasten. Da große Infrastrukturprojekte, wie etwa Solar- und Windparks, Wasserstoffprojekte oder geothermische Anlagen, in aller Regel nicht mit ortsansässigen, sondern mit Firmen der Geberländer umgesetzt werden, wirken auch Instrumente der Emissionsreduzierung oft lediglich als Profitmodell der eigenen Volkswirtschaften und nicht als Hilfe für die am meisten von der Klimakrise betroffenen Länder.
Während das Geld für Klimaanpassungsmaßnahmen fehlt, flossen 2022 rund sieben Billionen US-Dollar in Subventionen für fossile Energien. Weltweit wurden die Summen für Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit drastisch gekürzt oder gänzlich eingestellt, während die Rüstungsausgaben 2024 auf 2,7 Billionen Dollar stiegen. Eine klare Prioritätensetzung und Ausdruck des globalen Rechtsrucks, der im Kern die Bereitschaft bedeutet, Bewohner:innen ganzer Weltregionen und Teile der Bevölkerung der Industriestaaten zu opfern – trotz existierender Alternativen.
Entgegen einer dringend benötigten sozial-ökologischen Transformation zeichnet sich die Versicherheitlichung der Klimakrise ab. Anstatt die drohende planetare Verwüstung durch koordinierte, globale Anstrengungen für vermeidbar zu halten, wird sich in erster Linie auf die durch sie produzierten Sicherheitsrisiken vorbereitet. Dies betrifft die Sicherstellung der Einsatzfähigkeit nationaler Armeen ebenso wie die strategische Absicherung des Zugriffs auf Rohstoffe, Energie und Trinkwasserreserven durch Handelsabkommen, im Zweifel aber auch mit militärischen Mitteln. Der militarisierte Kohleabbau in Kolumbien, die Rodung ganzer Landstriche für Kupfer- und Nickelminen in Indonesien oder der Umbau Bosniens zu einer europäischen Rohstoffkolonie für Magnesium und Lithium, sind nur einige der zahlreichen Beispiele.
Auch die Migration, die als Folge der Zerstörung durch Klimakrisen ausgelöst wird, wird in NATO-Papieren bereits seit Jahren lediglich als Sicherheitsproblem bezeichnet, auf das es sich vorzubereiten gilt. Folgerichtig zur sang- und klanglosen Überschreitung des 1,5-Grad-Ziels werden die Zentren des globalen Nordens noch radikaler als bisher abgeschottet. Während in Deutschland das Klimaschutzgesetz und die Emissionsziele ganzer Industriezweige verwässert werden, militarisiert die EU ihre Außengrenze, höhlt das Recht auf Asyl aus, oder übergeht es durch Polizeipraktiken widerrechtlich, wo dieses Recht noch existiert. Die zukünftig bewohnbaren Regionen der Welt sollen nicht mit allen verbleibenden Menschen geteilt werden müssen.
Sicherheitslücke Klimaflucht
Laut dem Internal Displacement Monitoring Center gab es 2024 knapp 45,8 Millionen Binnenvertreibungen wegen Extremwetterereignissen und Naturkatastrophen. Der Weltklimarat stellt fest, dass sich das Risiko von Vertreibungen durch Überschwemmungen mit jeder Erwärmung um 1 °C um 50 Prozent erhöht.
Trotzdem ist Klimaflucht nicht als Fluchtursache anerkannt, eine Schutzregelung für Vertriebene und Geflüchtete existiert nicht und in der Definition sogenannter „sicherer Herkunftsländer“ wird die Option faktischer Unbewohnbarkeit gar nicht erst berücksichtigt. Die Beeinträchtigung grundsätzlicher Menschenrechte als Grundlage für einen Schutzstatus scheint vor dem Hintergrund eskalierender Klimakrisenschäden evident zu sein, denn der Zustand der uns umgebenden Umwelt strukturiert wesentlich die Möglichkeiten die in der Erklärung der allgemeinen Menschenrechte verankerten Rechte auch wahrnehmen zu können. Ein erst kürzlich vom Internationalen Gerichtshof veröffentlichtes Rechtsgutachten bestätigt die Wechselbeziehung zwischen Menschenrechten und dem Schutz der Umwelt und formuliert eine völkerrechtlich verbindliche Sorgfaltspflicht von Staaten, Klimaschäden zu verhindern, zu mindern und zu beheben. Das schließt die Verantwortung für Folgekoste durch Klimakrisenschäden mit ein. Ein Meilenstein, darin den Fokus von einem militärischen zu einem sozialen Sicherheitsbegriff zu verschieben.
Trotz dessen zeichnet sich eine baldige Schließung der klaffenden Sicherheitslücke für Klimakrisenvertriebene noch nicht ab. Ein migrationsfeindlicher Diskurs von Europa bis in die USA, der noch nicht mal Folter durch die Taliban oder systematische Bombardierung als Abschiebehemmnis anerkennt, steht dem wie eine Mauer im Wege. Es bedarf deswegen auch eines politischen Richtungswechsels zur Frage der Migration, denn Flucht und Migration sind die Folge zerstörerischer Politik und nicht deren Ursache.
Karin Zennig ist Klimareferentin bei der Hilfs- und Menschenrechtsorganisation medico international.