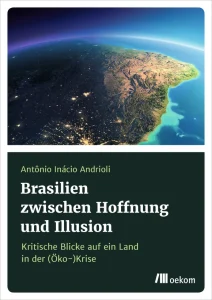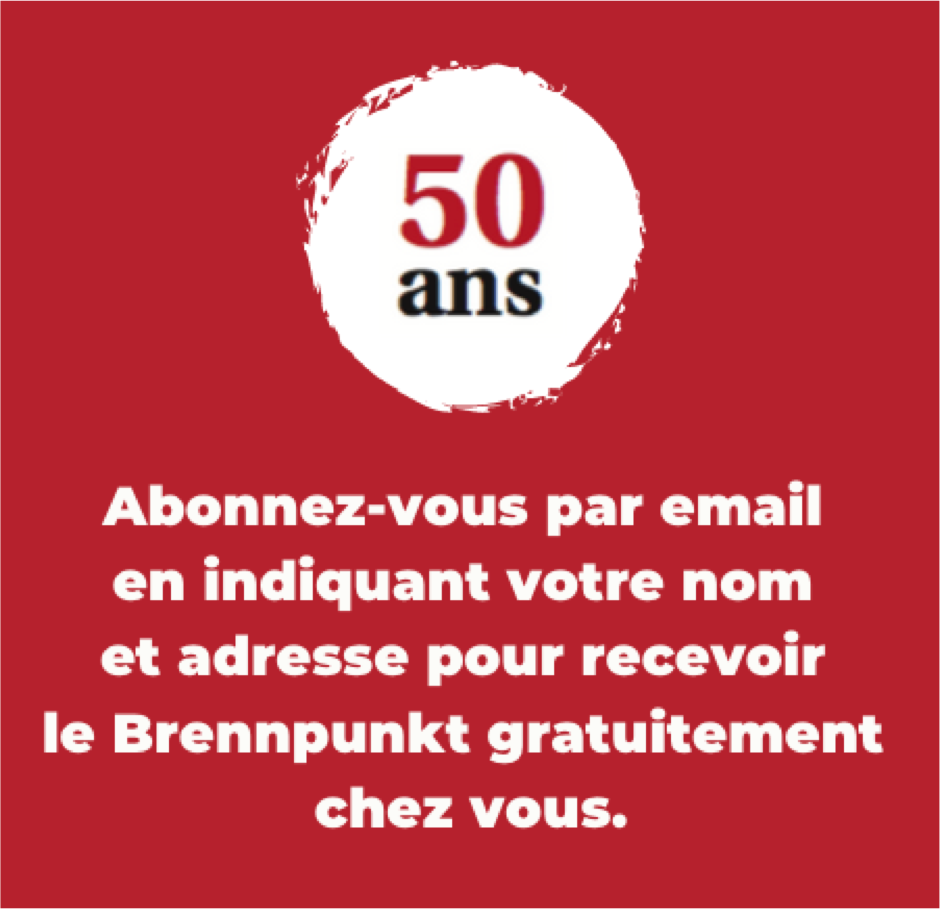Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur wird seit Langem dafür kritisiert, dass es die Agrarindustrie und große Exporteure begünstigt. Sehen Sie Potenzial für eine Version dieses Abkommens, die mit sozialer Gerechtigkeit und Umweltschutz vereinbar ist – oder ist es grundlegend fehlerhaft?
Dieses Freihandelsabkommen ist so veraltet, dass dabei nichts mehr zu retten ist. Es setzt auf die Abschaffung von Zöllen bei Produkten wie Autos, Fleisch und Pestizide, die wir eigentlich reduzieren sollten. Vor 25 Jahren, als die ersten Verhandlungen dazu begannen, gab es noch nicht das Pariser Abkommen, und viele glaubten weiter fest daran, dass durch mehr Außenhandel ein Wirtschaftswachstum für die Länder beider Kontinente zu erreichen sei. Derzeit wissen wir aber, dass aufgrund der zunehmenden Klimakatastrophen weltweit selbst die Idee eines unbegrenzten Wirtschaftswachstums in Frage gestellt wird und der hohe Energieverbrauch und die langen Transportwege eigentlich vermieden werden sollten. Andersrum ist eine lokale und umweltschonende Produktion die Chance für mehr soziale Gerechtigkeit, denn die Erhaltung einer gesunden und enkeltauglichen Umwelt ist nur möglich, wenn die Menschen, die seit Jahrtausenden gelernt haben, mit der biologischen Vielfalt vor Ort umzugehen, dort weiter im Einklang mit der Natur leben und arbeiten können. Weil dieses Abkommen aber der bäuerlichen Landwirtschaft und den traditionellen Völkern auf beiden Seiten des Atlantiks nur Schaden anrichten wird, ist es grundlegend fehlerhaft und sollte nach heutigem besten Wissen und Gewissen abgelehnt werden.
Larissa Bombardi, eine Landsfrau von Ihnen und, wie ich verstanden habe, eine Freundin, verwendet den Begriff „chemischer Kolonialismus” im Zusammenhang mit der Freihandelspolitik der EU. Was beschreibt sie damit und können Sie das näher erläutern?
Die Kollegin Larissa stellt damit den Doppelstandard oder die Doppelmoral der europäischen Handelspolitik beim Export von Pestiziden nach Lateinamerika deutlich dar. Es ist tatsächlich absurd, dass Produkte, die in Europa aufgrund ihrer gesundheitlichen und ökologischen Schädlichkeit nicht zugelassen sind, in anderen Teilen der Welt, wie in Brasilien, weiterverkauft werden. Das kann man am Beispiel der Pestizidexporte Europas gut erkennen. Über die Hälfte der am meisten eingesetzten Pestizide in Brasilien sind in Europa nicht zugelassen, als ob dieselben Wirkstoffe, die nach europäischen Untersuchungen als schädlich eingestuft wurden, irgendwoanders nicht schaden würden. Es handelt sich um ein sehr koloniales Denkmuster, als ob die Menschen in Lateinamerika weniger wert wären oder „zweiter Klasse“ seien. Ich kann ihrem Argument nur zustimmen. Larissas Forschungsarbeit ist für uns sehr wichtig, insbesondere um die kolonialen und neokolonialen Denkstrukturen auch in der Wissenschaft zu überwinden, die dort immer noch vorherrschen. Sie wurde weltweit bekannt, als sie den Pestizidatlas mit Hinblick auf das EU-Mercosur-Abkommen veröffentlichte, was jedoch dazu führte, dass sie in Brasilien mehrmals bedroht wurde und sich entschied, nach Europa zu flüchten, um in mehr Sicherheit forschen zu können. Der chemische Kolonialismus führt auch zu verschiedenen Standards bei der Zulassung, der Kontrolle und bei der Festlegung von Höchstwerten für Pestizidrückstände. Daraus entsteht die Konsequenz, dass nicht nur die Umwelt und die Menschen in Lateinamerika den Risiken solcher Gifte ausgesetzt sind, sondern selbst die Konsument:innen in der EU, die durch den Import von landwirtschaftlichen Produkten Rückstände der nicht zugelassenen Pestizide aufnehmen werden. Dadurch exportiert die EU Menschenrechtsverletzungen und importiert Umweltzerstörung.
Als Sie hier in Luxemburg auf der MECO-ASTM-Konferenz gesprochen haben, konnte man zwischen den Zeilen herauslesen, dass Sie „heimlich” für „weniger ist mehr” eintreten. Ist degrowth der richtige Weg oder haben Sie sich auf eine andere Alternative zum aktuellen sozioökonomischen Modell bezogen?
Ja, ich bin inzwischen davon überzeugt, dass wir von einem Modell der auf ständigem Wachstum basierenden Wirtschaft zu einem Konzept der Suffizienz kommen müssen, wenn wir davon ausgehen möchten, dass die Menschheit auf diesem Planeten überhaupt noch eine Überlebenschance haben kann. Anders formuliert: Es ist nicht mehr möglich, auf ewige Akkumulation von Kapital zu setzen, weil wir schon längst auf die ökologischen Grenzen dieser Produktionsweise gestoßen sind. Das ist aber die dominierende Tendenz unserer Zeit, denn auch Regierungen profitieren vom Wirtschaftswachstum als stabilisierender Funktion für die Regierbarkeit. Suffizienz sollte aber nicht mit Armut und Knappheit verwechselt werden. Es geht eher um die Priorisierung von lebenswichtigen Bereichen und die Verminderung der Ressourcenverschwendungen, die mit der Industrialisierung und der Expansion profitorientierter Aktivitäten zustande kamen. Wir brauchen dafür eine gemeinwohl- und postwachstumsorientierte Wirtschaft, in der der inzwischen verlorene Zusammenhang zwischen Ökologie und Ökonomie wiederhergestellt werden kann. Dies auf der Basis einer zunehmend demokratischen und nicht bürokratischen Gestaltung der Priorisierung bei der Nutzung von Naturressourcen. In vielen Teilen der Welt werden schon seit langer Zeit Formen von Solidarwirtschaft erlebt und ausprobiert. Es wäre eigentlich eine Form von Gemeinschaft, in der sowohl der Produktivismus als auch die Akkumulationslogik unseres aktuellen sozioökonomischen Modells überwunden werden, um zu einer Form des „Genug für alle“ zu kommen.
Brasilien befindet sich heute in einer widersprüchlichen Lage: Es fördert Handelsabkommen wie Mercosur, ist aber gleichzeitig Gastgeber der COP30 und präsentiert sich als Vorreiter im Klimaschutz. Wie interpretieren Sie diese Dualität? Ist es tatsächlich eine?
Es ist die Widersprüchlichkeit einer Regierung, die über keine Mehrheit im Parlament verfügt. Die Mehrheit der brasilianischen Abgeordneten und Senatoren vertritt die Interessen der Großgrundeigentümer und der Agrarindustrie, und für sie sind Naturschutz oder Menschenrechte keine Priorität. Dies ist deutlich bei der Verabschiedung des sogenannten „Zerstörungsgesetzes“ (PL da Devastação) zu sehen. Es geht dabei um die Lockerung von Umweltgesetzen, sodass Bergbauaktivitäten, die Entwaldung, die Umweltverschmutzung und die Expansion von Monokulturen für den Agrarexport in Naturschutzgebiete nicht mehr wie bisher vom Staat kontrolliert werden. Das Gesetz bedroht indigene Völker und ist verfassungswidrig. Hoffentlich nutzt Lula noch sein Vetorecht, um es zu verhindern. Obwohl es wichtige fortschrittliche Ansätze seitens der Regierung Lula gibt, wie die Wiederaufnahme der Umweltkontrollen, was z. B. zu einer Reduzierung von 30 % bei der Entwaldung in diesem Jahr geführt hat, versucht sie auch, beim Parlament mit der Förderung des EU-Mercosur-Freihandelsabkommens zu punkten. Noch schlimmer ist aber, dass Lula weiterhin auf fossile Brennstoffe setzen möchte und in Ölbohrungen an der Mündung des Amazonasflusses investiert – ausgerechnet da, wo die COP30 stattfinden wird. Genauso problematisch sind die Fortführung des auf Agrarexport abhängigen Landwirtschaftsmodells und die Weiterführung von großen Infrastrukturprojekten, die längst als umweltschädlich und als Bedrohung für traditionelle Völker gesehen werden. Dies alles im Jahr der COP30 im eigenen Land und zu einer Zeit, in der die brasilianische Regierung international für ihren ökologischen Diskurs bekannt wurde.
Was erwarten Sie als Mitglied der Beratergruppe von Lula hinsichtlich der Führungsrolle Brasiliens bei der COP30 in Belém?
Seit meiner Zeit als Mitglied der CTNBio (Brasilianische Technische Kommission für Biosicherheit), bin ich auch in einer Beratergruppe des Bundesministeriums für Agrarentwicklung und Familienlandwirtschaft tätig. Wir konnten uns dort regelmäßig mit verschiedenen Themen der Umweltpolitik des Landes beschäftigen. Es ist uns inzwischen sehr klar, dass die derzeitige brasilianische Regierung sich viel besser als die vorherigen (selbst die vorherigen Regierungen von Lula) in Bezug auf die großen Umweltprobleme der Welt positioniert. So z. B. die Ankündigung, bis zum Jahr 2030 die illegale Entwaldung zu stoppen, wodurch das Land die Möglichkeit hat, seine Verpflichtungen im Rahmen des Pariser Abkommens einzuhalten. Brasilien hat besondere Potenziale, die weltweit für Hoffnung sorgen können, und gerade die Chance, eine internationale Koalition zum Schutz des Amazonasgebietes zu organisieren. Mit 50 Mio. Hektar ist die Region, in der die COP zum ersten Mal stattfindet, das größte Regenwaldgebiet der Erde. Es ist für 20 % des Sauerstoffes der Welt zuständig und speichert 120 Mio. Tonnen Kohlenstoff in der Biomasse. Dieses Gebiet sollte unbedingt als Urwald erhalten bleiben, denn allein die Freisetzung dieser Kohlenstoffe in der Atmosphäre ist mit der Verbrennung fossiler Energien im Straßenverkehr weltweit über einen Zeitraum von zehn Jahren vergleichbar. Und Brasilien hat allein mit der Bekämpfung der Entwaldung das Potenzial, die Treibhausgase zu verringern, ohne damit der Gesellschaft zu schaden, mit geringen Kosten und verbunden mit einer weitreichenden Erhaltung der Artenvielfalt. Brasilien hat auch ein enormes Potenzial für die Erzeugung von Solar- und Windenergie, für die Kohlenstoffbindung, um Einkommen in der Landwirtschaft zu schaffen, und für die Erzeugung von Nahrungsmitteln bei gleichzeitigem Schutz von Wasser, Boden und biologischer Vielfalt. Dafür braucht das Land aber wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung der Umweltkriminalität, zur Beendigung der Nutzung von Erdöl und Kohle, zur Beschleunigung der Energiewende hin zu erneuerbaren Energien, zur Förderung der Agrarökologie und einer kohlenstoffarmen Landwirtschaft, zu Klimaanpassungs- und Klimaschutzstrategien in ländlichen und städtischen Gebieten mit einer Beendigung der immensen sozialen Ungleichheiten, sowie finanzielle Unterstützungsmaßnahmen für die ökologische Umgestaltung von Produktionsketten und massive Investitionen in lokal angepasste Wissenschaft und Technologie. All das könnte die Regierung Lula auf der COP30 als Maßnahmen ankündigen und für internationale Zusammenarbeit plädieren. Anders als bei vorherigen COPs wäre das eine konkrete und umsetzbare Perspektive, die von einem Land kommt, das 1992 in Rio de Janeiro für die erste große internationale Umweltkonferenz nach Stockholm 1972 dafür bekannt wurde, neue und dringende Maßstäbe in der internationalen Umweltpolitik zu setzen.
Wie können zivilgesellschaftliche Bewegungen – sowohl im Globalen Süden als auch im Globalen Norden – ein Gegengewicht zur Dominanz der Unternehmensinteressen in globalen Politikforen wie der COP30 oder in Handelsverhandlungen bilden?
Bei solchen großen Konferenzen ist das Treffen von zivilgesellschaftlichen Bewegungen parallel zu dem offiziellen Programm schon immer von besonderer Bedeutung gewesen, weil sie als Reaktion auf Regierungen und die dominierenden Interessen von Konzernen entstanden sind. Es ist längst bekannt, dass beim sogenannten offiziellen Teil dieser Konferenzen wenig erreicht wurde, entweder weil die Zielsetzungen nicht ausreichen oder die gemeinsamen Verpflichtungen danach nicht eingehalten werden. Die Vernetzung von Organisationen der Zivilgesellschaft ist aber entscheidend gewesen, damit der Druck auf Regierungen, Parlamente und selbst auf Konzerne, die sich als größte Verursacher der meisten Umweltprobleme als umweltfreundlich präsentieren, entsteht. So ist der Diskurs bei solchen Konferenzen besonders von der Teilnahme der zivilgesellschaftlichen Bewegungen abhängig, die sowieso kritisch gegenüber den Abschlüssen der vorherigen Konferenzen eingestellt sind und leider nicht erwarten können, dass Regierungen dabei die Interessen der Mehrheit der Gesellschaft vertreten. Genauso wie bei Handelsverhandlungen ist der Druck von der Zivilgesellschaft und von der Öffentlichkeit die einzige Chance, die Stimmen der am stärksten Betroffenen ernst zu nehmen und zu vertreten. In Belém wird wahrscheinlich die Vertretung der Stimme von traditionellen Völkern die wichtigste sein, denn ohne sie ist die Erhaltung der Natur sowieso nicht möglich. Regierungen sollten darauf reagieren, aber die Durchsetzung der Interessen von Indigenen, Kleinbauern und -bäuerinnen und der Jugend – also der am stärksten von Umweltkatastrophen betroffenen Gruppen – kann meines Erachtens nur im Rahmen einer breiten internationalen Solidarität erfolgen, die besonders vor und nach der COP30 einen Raum findet. In dieser Hinsicht besteht die Hoffnung, dass eine kritische Öffentlichkeit daran teilnimmt und weiter in Bewegung bleibt.
| Brasilien zwischen Hoffnung und Illusion. Kritische Blicke auf ein Land in der (Öko-) Krise
Brasilien ist ein Land mit ausgeprägter sozialer Ungleichheit. Gleichzeitig verfügt es über enorme Naturressourcen und sehr unterschiedliche Klimazonen, die eine riesige biologische Vielfalt hervorgebracht haben und den Anbau fast aller Kulturpflanzen ermöglichen. Die Wirtschaftsstruktur aber ist nach wie vor stark von Agrarexporten geprägt, basierend auf Monokulturen wie Kaffee, Soja und Zuckerrohr. Somit wurde das Land zunehmend für Entwaldung, Landkonzentration, Korruption, Pestizideinsatz und Vertreibung indigener Völker bekannt. https://www.oekom.de/buch/brasilien-zwischen-hoffnung-und-illusion-9783962382605 |