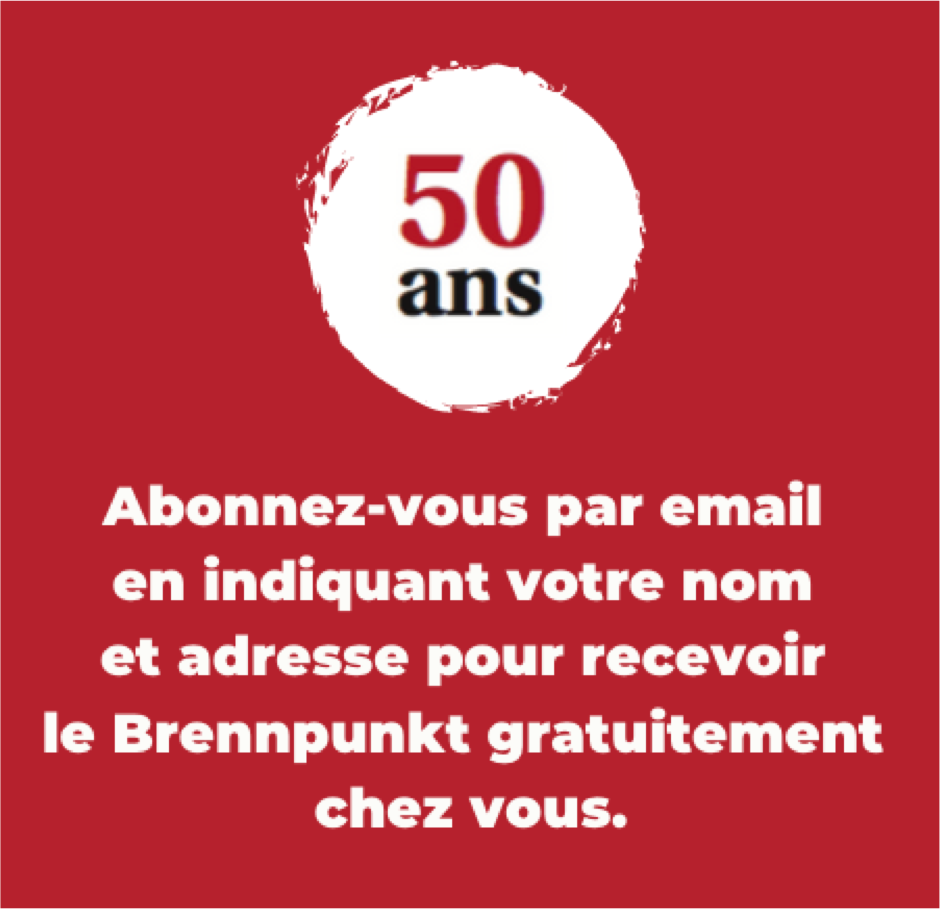Vor einem Jahr haben wir im Brennpunkt 325 die fortschreitende Einschränkung des zivilen Raums in Lateinamerika beschrieben. In den vergangenen Monaten hat sich die Situation weiter erheblich verschlechtert. In Ländern wie Ecuador, Peru und vor allem El Salvador sind signifikante Rückschritte bei der Wahrung demokratischer Grundrechte und der Freiräume für die Zivilgesellschaft zu verzeichnen. Die dortigen Regierungen greifen zunehmend zu rechtlichen und administrativen Methoden, um kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen. Restriktive Gesetze, die Kriminalisierung von Protesten, die Aushöhlung rechtsstaatlicher Strukturen und die enge Verflechtung mit wirtschaftlichen und kriminellen Akteuren bedrohen nicht nur zivilgesellschaftliche Organisationen, sondern die Demokratie insgesamt.
Peru: verstärkte staatliche Kontrolle unter dem Vorwand der Transparenz
Ein dunkler Tag für die peruanische Demokratie – so bezeichnet nicht nur die peruanische Zivilgesellschaft den 14. April 2025. Auch internationale Stimmen (etwa die Interamerikanische Menschenrechtskommission oder UN-Sonderberichterstatter) haben sich gegen das an jenem Tag verabschiedete Gesetz ausgesprochen, das alle zivilgesellschaftlichen Organisationen, die Mittel aus der internationalen technischen Zusammenarbeit erhalten, massiv in der freien Ausübung ihrer Arbeit einschränkt. Mit dem neuen Gesetz werden diese Organisationen unter die verstärkte Kontrolle der peruanischen Agentur für internationale Zusammenarbeit (Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI) gestellt. 2002 gegründet, bestand die Aufgabe der APCI ursprünglich darin, ausländische Hilfsgelder zu registrieren und zu koordinieren. Mit den Gesetzesänderungen wird die APCI jedoch zu einem Kontrollorgan mit weitreichenden Befugnissen. So ist die Registrierung bei der APCI für NGOs Pflicht, ebenso wie das Vorlegen von jährlichen Arbeitsplänen. Bevor internationale Gelder in Projekten ausgegeben werden können, müssen diese von der APCI genehmigt werden. Andernfalls können Sanktionen auferlegt werden, wie etwa die Löschung der APCI-Registrierung oder Geldstrafen von bis zu umgerechnet 640.000 Euro.
Dieses Gesetz zielt eindeutig darauf ab, das Recht auf Vereinigungsfreiheit einzuschränken und unter dem Vorwand einer größeren Transparenz die kritische Zivilgesellschaft mundtot zu machen. Die peruanische Präsidentin hat in den vergangenen Monaten NGOs öffentlich als Terroristen und Kriminelle bezeichnet. Dem neuen Gesetz nach ist es nun ein schwerwiegender Verstoß, erhaltene Gelder zur Unterstützung von Klagen gegen den peruanischen Staat in nationalen oder internationalen Instanzen zu verwenden. So wäre es nun zum Beispiel strafbar, Menschen, die anlässlich von Antiregierungsprotesten festgenommen wurden, juristischen Beistand zu leisten. Ein weiteres Beispiel nennt Ana Leyva der ASTM-Partnerorganisation CooperAcción: „Nehmen wir den Fall einer Person, die von einer korrupten staatlichen Instanz ihres Landbesitzes beraubt wurde und nicht über die notwendigen Mittel verfügt, um sich zu verteidigen. Mit diesem Gesetz verbietet der Staat es NGOs, diese Person mit Mitteln der internationalen Zusammenarbeit zu verteidigen, um ihr Eigentum zurückzuerhalten.“ Die vulnerabelsten Menschen bleiben ohne Rechtsschutz, was der Straflosigkeit Vorschub leistet.
El Salvador: vom populären „coolsten Diktator“ zur Eskalation der Repression
Präsident Nayib Bukele trat 2019 mit dem Versprechen an, der Kriminalität ein Ende zu setzen und El Salvador zu einem sicheren Land zu machen. Obwohl seine radikale mano dura-Politik mit Massenverhaftungen von mutmaßlichen Gangmitgliedern mit Verletzungen grundlegender Bürgerrechte einherging, führten sinkende Kriminalitätsstatistiken zu einem erhöhten Sicherheitsempfinden und Bukeles hoher Popularität in weiten Teilen der Bevölkerung. Seit März 2022 gilt in El Salvador ununterbrochen der Ausnahmezustand. Der Abbau der Demokratie und des Rechtsstaates hat sich seit Beginn von Bukeles verfassungswidriger zweiter Amtszeit im Jahr 2024 noch massiv beschleunigt. Im Mai 2025 erreichte die Repression schließlich bisher unbekannte Ausmaße.
Am 12. Mai wurde ein friedlicher Protest von mehr als 300 Familien einer Gemeinde in der Nähe der Hauptstadt San Salvador brutal unterdrückt. Diese hatten sich mobilisiert, um von der Regierung eine Lösung für die drohende Zwangsräumung zu fordern. Die Demonstranten wurden von einer Einheit der nationalen Zivilpolizei aufgelöst, zusammen mit der Militärpolizei, die hier erstmals zum Einsatz kam, obwohl sie rechtlich nicht für die Kontrolle der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zuständig ist. Dabei kam es zu körperlichen Übergriffen gegen die Demonstranten und der willkürlichen Festnahme eines Umweltschützers und eines Pastors.
Am 18. Mai 2025 wurde Ruth López, Anwältin der Menschenrechtsorganisation Cristosal, verhaftet. López hatte sich wiederholt kritisch gegen Korruptionsfälle in der Regierung Bukele sowie deren menschenrechtswidrige Politik geäußert, wie auch zuletzt gegen die Inhaftierung von Venezolanern in El Salvador, die von der Trump-Regierung aus den USA abgeschoben worden waren. Cristosal hatte auch zusammen mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen Beschwerde gegen ein neues Bergbaugesetz eingelegt. Einen Monat nach López’ Verhaftung kündigte Cristosal an, das Land aufgrund der zunehmenden Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidigern und rechtlicher Drohungen seitens der Regierung verlassen zu müssen.
Die eskalierende Repression unter Bukele richtet sich nicht nur gegen NGOs, sondern auch gegen Journalisten. Im Mai musste ein Großteil der Redaktion der investigativen Online-Zeitung El Faro das Land verlassen, nachdem sie von ihrer bevorstehenden Verhaftung erfahren hatte. El Faro hatte kurz zuvor Interviews mit hochrangigen Gangmitgliedern veröffentlicht, die bestätigten, dass sie bereits vor Bukeles erster Amtszeit geheime Verhandlungen mit diesem geführt und seinen politischen Aufstieg unterstützt hatten. Im Juni gab der salvadorianische Journalistenverband bekannt, dass etwa 40 Journalisten verschiedener salvadorianischer Medien das Land in den vorigen Wochen hatten verlassen müssen.
Am 20. Mai 2025 verabschiedete das salvadorianische Parlament ein Gesetz gegen ausländische Agenten, nach russischem Vorbild. Dies war bereits Bukeles zweiter Anlauf, nachdem ein erster Versuch eines solchen Gesetzes 2021 noch aufgrund von starkem internationalem Protest aufgegeben worden war. Das Gesetz, das ohne Anhörung oder öffentliche Debatte verabschiedet wurde, führt bürokratische Hürden und Kontrollen für zivilgesellschaftliche Organisationen ein sowie eine 30%-Steuer auf Gelder der internationalen Kooperation. Seit Inkrafttreten des Gesetzes am 7. Juni 2025 müssen sich alle Organisationen, die Gelder aus dem Ausland erhalten, als ausländische Agenten in ein staatliches Register eintragen lassen. Neben der Besteuerung der erhaltenen Gelder müssen sie sich auch dazu verpflichten, keine politischen Aktivitäten auszuüben, die das Ziel haben, „die öffentliche Ordnung zu stören“ oder „die soziale und politische Stabilität des Landes zu gefährden“. Das Gesetz verleiht Bukeles Regierung weitreichende Befugnisse zur Kontrolle, Stigmatisierung und Sanktionierung von NGOs und unabhängigen Medien, die internationale Unterstützung erhalten. Während internationale Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch sofort davor warnten, dass das neue Gesetz die Meinungs- und Versammlungsfreiheit untergräbt, gab es nur wenige und vorsichtige öffentliche Kritik von Seiten der internationalen Gemeinschaft.
Am 31. Juli 2025 schließlich verabschiedete das von der Regierungspartei dominierte Parlament in einem Eilverfahren eine drastische Verfassungsreform, die eine unbegrenzte Wiederwahl des Präsidenten ermöglicht, dessen Amtszeit von fünf auf sechs Jahre verlängert und die Stichwahl abschafft.
Ecuador: Noboa nimmt sich Bukele zum Vorbild
Wie Nayib Bukele in El Salvador trat Daniel Noboa 2023 sein Amt als Präsident Ecuadors mit einer mano dura-Rhetorik an. Ecuador hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Knotenpunkt für den internationalen Kokainhandel entwickelt, als Transitland zwischen den produzierenden Ländern Kolumbien und Peru sowie den Hauptabsatzmärkten in den USA und Europa. Damit einher ging ein starker Anstieg der organisierten Kriminalität und eine Explosion der Mordraten. Kriminelle Gruppen übernahmen die Kontrolle über das Gefängnissystem, wobei sie von der grassierenden Korruption profitieren, die den Sicherheits- und Justizapparat sowie die politische Klasse des Landes unterwandert hat. Als Antwort auf die Gewaltkrise hat Noboa seit Januar 2024 wiederholt den Ausnahmezustand verhängt und das Militär im Inland eingesetzt. Dies hat jedoch nicht zu einer Verbesserung der Situation geführt, sondern zu einem verstärkten Machtmissbrauch durch das Militär und Polizeikräfte, was insbesondere im Dezember 2024 durch die Tötung von vier Jugendlichen durch das Militär in Guayaquil in die Öffentlichkeit rückte.
Seit dem Beginn von Noboas zweiter Amtszeit im Mai 2025 scheinen sich die autoritären Tendenzen noch zu verschärfen. Die nationale Sicherheit wird zunehmend als Vorwand für eine Einschränkung der Grundrechte genutzt. Am 10. Juni 2025 wurde in Ecuador ein neues Geheimdienstgesetz verabschiedet, das nicht nur von Menschenrechtsverteidigern, sondern auch von Juristen und Sicherheitsexperten massiv kritisiert wird. Das Gesetz schafft einen rechtlichen Rahmen für die Arbeit des Nationalen Nachrichtendienstes, der in der Vergangenheit immer wieder von Missbrauch von Geldern sowie Skandalen wegen seiner Instrumentalisierung für bestimmte politische Zwecke geprägt war. Das neue Gesetz räumt der Exekutive ein System der Massenüberwachung ohne gerichtliche oder parlamentarische Kontrolle und ohne echte Rechenschaftspflicht ein. So verpflichtet es Telefongesellschaften, Informationen über ihre Nutzer für nachrichtendienstliche Zwecke herauszugeben, ohne dass hierfür ein richterlicher Beschluss erforderlich ist. Es erlaubt darüber hinaus das Abhören von Kommunikationen und die Beschlagnahmung von Dokumenten ohne richterliche Genehmigung. Eine Gruppe von zivilgesellschaftlichen Organisationen aus Ecuador fasst die zentralen Kritikpunkte am Gesetz folgendermaßen zusammen: es verletze das Recht auf Privatsphäre und ein ordnungsgemäßes Verfahren, gewähre Geheimdienstmitarbeitern Straffreiheit, ermögliche die politische Nutzung des Geheimdienstsystems, schwäche Transparenz und Demokratie und verstoße gegen internationale Menschenrechtsstandards.
Dabei ist das Geheimdienstgesetz nicht das einzige besorgniserregende Gesetz in Noboas erst kurzer zweiter Amtszeit: ein neues Gesetz der „nationalen Solidarität“ räumt dem Präsidenten weitreichende Befugnisse zur Ausrufung und Bekämpfung eines „internen bewaffneten Konflikts” ein. Dadurch können Sicherheitskräfte in Situationen, in denen dies nach ecuadorianischem Recht eigentlich verboten wäre, tödliche Gewalt anwenden. Das offensichtliche Ziel des Gesetzes ist es, den Behörden mehr Spielraum bei der Verbrechensbekämpfung zu geben, indem Menschenrechtsbestimmungen außer Kraft gesetzt werden. Ein weiteres, von UNICEF stark kritisiertes Gesetz der „öffentlichen Integrität“ sieht eine Verschärfung der Strafen für Minderjährige vor, indem es ermöglicht, Minderjährige in Ecuador wie Erwachsene zu verurteilen.
Und schließlich wurde im Juni 2025 ein Gesetzesentwurf im Parlament vorgelegt, der laut ASTM-Partnerorganisation Acción Ecológica schwerwiegende Folgen für Schutzgebiete in Ecuador sowie für die dort lebenden Gemeinschaften haben könnte. Die ecuadorianische Verfassung hält zwar die Pflicht des Staates fest, geschützte Naturgebiete zu erhalten. In der Realität gibt es dort jedoch zahlreiche Probleme, von mangelnden Ressourcen für die Verwaltung der Schutzgebiete bis hin zu illegalem Bergbau und Abholzung. Der aktuelle Gesetzesentwurf geht diese Probleme jedoch nicht an, sondern öffnet unter dem Vorwand der lokalen wirtschaftlichen Entwicklung die Tür für privatwirtschaftliche Investitionen und die Militarisierung dieser Gebiete. Der Einsatz von Überwachungstechnologien würde durch das Gesetz ermöglicht, was über die Kontrolle des illegalen Bergbaus hinaus zu einer Überwachung der indigenen Bevölkerung und von Bergbaugegnern führen könnte. Darüber hinaus verletzt der Gesetzesentwurf indigene Rechte, wie sie in der von Ecuador ratifizierten ILO-Konvention 169 festgeschrieben sind.
Folgen für die ASTM-PartnerorganisationenIn allen drei Ländern arbeitet ASTM seit Jahren mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen. In Ecuador befasst sich Acción Ecológica mit den Auswirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten wie Ölförderung, Bergbau und Landwirtschaft, und setzt sich für den Schutz des Amazonas-Regenwaldes und die Verteidigung der Ernährungssouveränität der indigenen Bevölkerung ein. Colectiva Feminista unterstützt Frauen im ländlichen Raum in El Salvador angesichts verschiedener Formen von Gewalt, Diskriminierung und Ausgrenzung. Und in Peru setzt sich ADECAP für den Schutz der Landrechte der andinen Bevölkerung ein, Fedepaz begleitet bäuerliche und indigene Gemeinschaften, die von Bergbau- und Ölaktivitäten betroffen sind und kriminalisiert werden, und CooperAcción engagiert sich für die Ausübung politischer, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte in Gebieten mit extraktiven Aktivitäten. Die weitere Arbeit all dieser Organisationen ist durch die repressiven und autoritären Tendenzen in den jeweiligen Ländern unmittelbar bedroht. Besonders in El Salvador stellt sich ganz konkret die Frage, ob Colectiva Feminista ihre Arbeit fortführen kann und inwieweit die ASTM die Organisation dabei weiter unterstützen kann. |