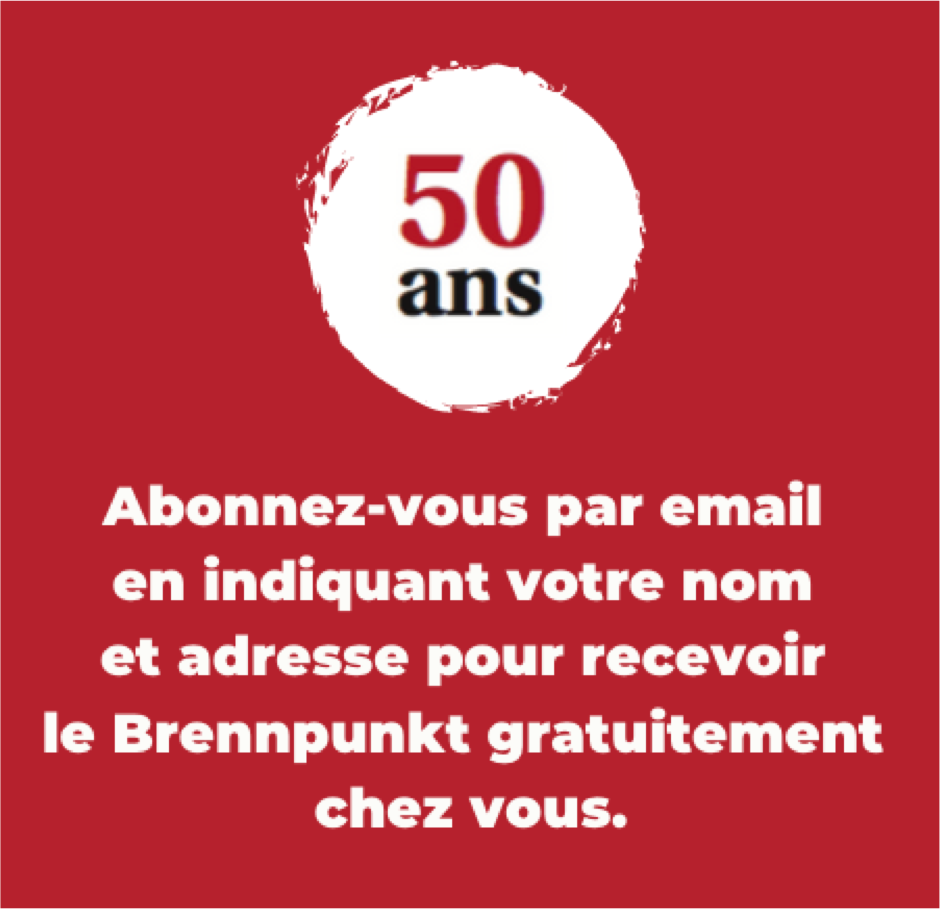In Indiens stark polarisierter Gesellschaft, in der abweichende Meinungen als antinational bestraft werden und die Hysterie blutrünstiger Nationalisten einen Krieg zwischen Pakistan und Indien zur neuen Normalität macht, riskiert das Reden über Frieden als Verrat gebrandmarkt zu werden. Als Indien und Pakistan im Mai 2025 jedoch in einen Strudel der Kriegshysterie gerieten, brachen Friedensaktivisten auf beiden Seiten der Grenze langsam aus ihrer ängstlichen Isolation aus und appellierten, den Krieg zu beenden. Schlummernde Friedensforen nahmen den Dialog wieder auf und behaupteten nachdrücklich, dass die Menschen auf beiden Seiten Frieden wollten. Die Dringlichkeit und Eindringlichkeit des Aufrufs zur Wiederaufnahme der unterbrochenen diplomatischen und zwischenmenschlichen Beziehungen wurde durch die Besorgnis über ein neues Kriegsmuster vorangetrieben: der Einsatz militärischer Gewalt als erste Option in einer eskalierenden Konfrontation zwischen zwei atomar bewaffneten Nachbarn mit strukturellen Konfliktvermächtnissen.
Am 22. April hatte in Pahalgam, im indisch kontrollierten Teil Kaschmirs, ein abscheulicher Terroranschlag das staatlich geförderte Narrativ der „Normalisierung” erschüttert und 25 indischen Touristen sowie einem einheimischen Kaschmiri, der sie zu schützen versuchte, das Leben gekostet. Indien stellte umgehend eine Verbindung zwischen dem Terroranschlag und Pakistan her – basierend auf dem bekannten Muster grenzüberschreitender Terroranschläge durch Stellvertreter – und etablierte eine neue Normalität, indem es den Indus-Wasservertrag aussetzte, der bereits drei Kriege zwischen Indien und Pakistan überdauert hatte, und ihn als Waffe einsetzte. Inmitten der von den Medien verstärkten Kriegsrhetorik aktivierte Indien seine neue Strategie und ging militärisch gegen die vermutete Quelle der „Terror”-Infrastruktur vor. Dies eskalierte zu vier Tagen gegenseitiger Luftraketenangriffe mit der latenten Gefahr eines Atomkrieges. Der willkommene, wenn auch ungeklärte Waffenstillstand (verwirrt durch die umstrittene Vermittlungsbehauptung von US-Präsident Donald Trump) empörte lautstarke Nationalisten, die den Grenzkrieg mit dem kommunalen „Krieg” im Inneren verbanden. Die beiden Staaten haben grenzüberschreitende ethnisch-religiöse Gemeinschaften, wobei die Minderheit in einem Staat die Mehrheit im anderen ist, d. h. Hindus in Pakistan und Muslime in Indien. Im aufkommenden Hindu-Majoritarismus wurden muslimische Bürger als Stellvertreter des Anderen, als „Feind“ diffamiert, und alle Kaschmiris galten als schuldig und wurden mit kollektiven Strafen belegt.
Ironischerweise gab es keine Forderungen nach einer politischen Auseinandersetzung mit dem Kernkonflikt um Kaschmir zwischen diesen beiden postkolonial geteilten, unabhängigen Staaten. Das politische Vorhaben der Hindu-nationalistischen Regierung Indiens, im Jahr 2019 den Sonderstatus Kaschmirs durch die Aufhebung von Artikel 370 der Verfassung(1) zu entziehen, hatte Pakistan dazu veranlasst, die diplomatischen Beziehungen sowie die vertrauensbildenden Strukturen in Handel und Verkehr aufzukündigen. Der Terroranschlag führte zur Ausweisung der Bürger des jeweils anderen Landes und zum Bruch von Beziehungen zwischen Familien und Freunden.
In der einst dynamischen indisch-pakistanischen Friedensbewegung, die es gewagt hatte, sich einen Austausch zwischen Menschen vorzustellen, die eine neue Friedensgeschichte schreiben könnten, riefen Kriegshetzer „Kein Land für Pazifisten“. Die Verankerung hinduistischer Mehrheitsdiskurse in Indien und der Aufstieg des Militärs im zivil-militärischen Verhältnis in Pakistan hatten die durch den Tod einflussreicher Persönlichkeiten geschwächten Friedensaktivisten, isoliert. Hatte sich der Friedensaktivismus in die südasiatische Diaspora zurückgezogen, etwa in Form des South Asia Peace Action Network (SAPAN)? (2)
Doch trotz des Säbelrasselns und der hohen Kosten „anti-nationaler“ Dissidenz entstanden unzählige zivilgesellschaftliche Initiativen. Der erfahrene Sozialaktivist Sandeep Pandey organisierte eine Reihe virtueller Dialoge bei denen altbekannte, aber auch neue Friedensaktivisten, Wissenschaftler, Medienvertreter, Künstler, Frauen- und Sozialrechtler sowie ehemalige politische Führer zum Austausch zusammenkamen.
Am 18. Juni 2025 wurde ein Dialog vom Pakistan-India Forum for Peace and Democracy (PIPFPD) (3) organisiert. Die Diskussion zum Thema „Die Kosten des pakistanisch-indischen ‚Krieges‘“ beleuchtete die humanitären, sozialen, politischen, militärischen und wirtschaftlichen Aspekte des Konflikts. Auch die Notlage der Kaschmiris in den Todesfeldern an der Grenze, die zu Kollateralschäden reduziert wurden und durch die Massenverhaftungen nach dem Terroranschlag stark gelitten hatten, wurde aus dem Randbereich ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Die Herausgeberin der Kashmir Times, Anuradha Bhasin, sowie Journalist:innen von beiden Seiten der Kaschmir-Grenze berichteten über die 21 getöteten Zivilist:innen und die drakonischen Verhaftungen nach dem Terroranschlag.
Am Dialog nahmen sowohl bekannte Gesichter als auch neue Stimmen teil. Indische und pakistanische Kernphysiker setzten sich mit der Frage auseinander, ob die nukleare Bedrohung zum Waffenstillstand geführt habe, stellten die Wirksamkeit der Abschreckung zwischen zwei atomar bewaffneten Nachbarn infrage und stellten sich die konkreten Folgen eines nuklearen Fallouts vor. Unter den Teilnehmer:innen waren auch Journalisten, Wissenschaftler, Künstler, Aktivisten für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte sowie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Es ging ihnen vor allem, in einer offenen Diskussion die Zusammenhänge und Komplexitäten der Kaschmirfrage besser zu verstehen. Der Akademiker Taimur Rahman fasste den strukturellen Konflikt zwischen Indien und Pakistan zusammen. Der indische Journalist Zia Us Salam sprach darüber, wie es ist, in Indien Muslim zu sein, während der indische Anwalt Shah Rukh Alam sich gegen eine reduktionistische Darstellung von Identität aussprach. Allgemeine Empörung herrschte über die kriegstreiberische Berichterstattung der Medien sowie Besorgnis über die Vernachlässigung von Entwicklungsprioritäten, die sich aus dem Terroranschlag in Pahalgam resultierte.
Neben diesen Dialogen wurden ferner in einer bemerkenswerten Initiative von O.P. Shah vom Centre for Peace and Progress in Delhi unabhängige ‚Track-Two‘-Gespräche organisiert. An diesen hybriden sowie virtuellen Gesprächen nahmen ehemalige Minister, Diplomaten, nationale Sicherheitsberater, Politiker und Friedensaktivisten teil. Zwar dominierte eine realistische Perspektive, doch herrschte Einigkeit über die Notwendigkeit, den diplomatischen Dialog und sogar die zwischenmenschlichen Beziehungen auf beiden Seiten der Grenze wiederzubeleben und aufrechtzuerhalten.
Unter den verschiedenen Friedenserklärungen, die in dieser Zeit veröffentlicht wurden, war der gemeinsame Aufruf von Feministinnen aus Indien und Pakistan von besonderer Bedeutung. Rund 7.750 Frauen forderten darin die Ablehnung der Logik des Krieges, die „in Nationalismus, in toxischer Männlichkeit und Grenzen aus der Kolonialzeit verwurzelt sei“. Als besonders anstößig empfanden die Feministinnen die patriarchale Bezeichnung der nach dem Anschlag von Pahalgam von Indien gestartete Militäroperation „Operation Sindoor” (eine zinnoberrote Markierung, die eine verheiratete Hindu-Frau symbolisiert). Sie verurteilten diese Bezeichnung als Instrumentalisierung des Leids der Frauen, die durch den Terroranschlag zu Witwen geworden waren, als Kriegsruf.
Angesichts des wieder aufflammenden Triumphalismus in den Kriegsdarstellungen anlässlich der offiziellen Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag in Indien und Pakistan waren Friedensgruppen in beiden Ländern entschlossen, die seit 30 Jahren bestehende Tradition der Mahnwache bei Kerzenschein auf beiden Seiten der Grenze am 14. und 15. August fortzusetzen. Obwohl die indischen Behörden den Zugang zum Grenzposten Attari sperrten, hielten etwa 200 pakistanische Aktivist:innen die Tradition am Grenzposten Wagah aufrecht. Dies wurde durch Veranstaltungen verstärkt, die vom Hind Pakistani Dosti Manch (Indisch-Pakistanisches Freundschaftsforum) in Amritsar organisiert wurden. In Lahore hielten die South Asia Free Media Association (SAFMA) und linke Parteien ein Seminar mit dem Titel „Make Peace the New Normal” ab.
Die indisch-pakistanische Friedensbewegung ist also keineswegs erloschen.
Rita Manchanda ist Forscherin, Autorin und Menschenrechtsaktivistin mit Schwerpunkt auf Konflikten und Friedensförderung in Südasien. Sie befasst sich insbesondere mit der Rolle der Zivilgesellschaft, vor allem der Frauen, bei der Friedensförderung in der Region. Sie ist leitende Geschäftsführerin und Forschungsdirektorin der Nichtregierungsorganisation South Asia Forum for Human Rights (SAFHR) und hat zahlreiche Publikationen zu den Rechten von Minderheiten und Flüchtlingen sowie zu den Strategien zivilgesellschaftlicher Organisationen angesichts schwindender Handlungsspielräume veröffentlicht.
Notizen :
(1) Artikel 370 war eine vorübergehende Bestimmung, die 1949 in die indische Verfassung aufgenommen wurde. Sie gewährte dem Fürstentum Jammu und Kashmir einen Sonderstatus, als es zur Zeit der Machtübergabe von der britischen Herrschaft zur Indischen Union beitrat. Jammu und Kashmir war der einzige Staat Indiens mit muslimischer Mehrheit. Im Jahr 2019 hob die indische Regierung Artikel 370 auf, wodurch der Staat in die beiden Unionsterritorien Jammu und Kashmir sowie Ladakh aufgeteilt wurde.
(2) SAPAN ist ein Solidaritätsbündnis aus Einzelpersonen und Vertretern von Organisationen, die eine Verbindung zur Region Südasien haben. Es setzt sich für Frieden, Gerechtigkeit und Demokratie in der Region ein. Das Bündnis hat seinen Sitz in der Diaspora, wird jedoch von vielen Menschen innerhalb der Region unterstützt.
(3) Das 1994 von einer Gruppe namhafter Persönlichkeiten aus Pakistan und Indien gegründete Pakistan-India Forum for Peace and Democracy (PIPFPD setzt sich für einen zwischenmenschlichen Austausch, den Abbau von Trennlinien und den Aufbau eines politischen Dialogs,unter anderem in Bezug auf Kaschmir ein, einen politischen Konflikt, dessen Lösung die Bevölkerung Kaschmirs auf beiden Seiten der Grenze einbeziehen muss.